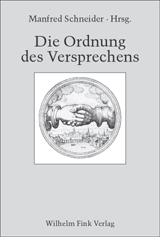|
Manfred Schneider (Hg.)
DIE ORDNUNG DES VERSPRECHENS
NATURRECHT - INSTITUTION - SPRECHAKT
In Zusammenarbeit mit Peter Friedrich, Michael Niehaus und Wim Peeters
2003, ca. 400 Seiten, kart.,
ca. € 34,90
ISBN 3-7705-3835-8
Reihe: Literatur und Recht; 1
Ist das Versprechen ein Vertrag, ein Satz, eine Verpflichtung oder
eine Handlung? Seit zweitausend Jahren analysieren Priester, Juristen,
Philosophen, Sprachwissenschaftler die Verbindlichkeiten, die das
Versprechen stiftet, seinen Ursprung und seine Form, sein Gelingen
und Misslingen, seine Macht und seine Ohnmacht. Große Namen
des Naturrechts haben sich der Analyse des Versprechens gewidmet:
Cicero, Grotius, Hobbes, Pufendorf, Thomasius. Im 19. Jahrhundert
bricht diese Tradition plötzlich ab und verzeichnet nur noch
Nietzsches Genealogie zum Versprechenstier Mensch. Doch im 20. Jahrhundert
nehmen Sprach- und Diskurstheoretiker die alte Frage der Juristen
wieder auf: Wie lässt sich die Kraft einer Äußerung
erfassen, die sich Versprechen nennt? Zu ihnen zählen Austin,
Searle, Habermas, Apel, Derrida. Während im Naturrecht das
Versprechen Rechtsverbindlichkeit ohne Hilfe von Anwälten herbeiführen
sollte, wollen Kommunikationstheoretiker heute durch die Versprechensanalyse
die Sprache als ein vorinstitutionelles, vernünftiges Korrektiv
im demokratischen Rechtswesen erweisen. Über dieser gebrochenen
und unterbrochenen Geschichte theoretischer Sprachreflexion wölbt
sich als unabgelöster Rest der christlichen Metaphysik das
Versprechen der Erlösung. Dagegen steuert die Literatur viele
Einzelgeschichten von Fällen gebrochener Versprechen bei: Für
sie alle brennt Don Juan in der Hölle.
Einleitung: Manfred Schneider
I. Versprechen und Illokution
Rüdiger Campe:
Making it Explicit, oder: eine Vorgeschichte des Sprechakts bei
Austin
Eckard Rolf:
Das Versprechen der Sprechakttheorie
Peter Friedrich:
„Die sogenannte Institution des Versprechens.“ Zur transzendentalpragmatischen
Sprachpolitik
II. Naturrecht
Karl Schuhmann:
Die Theorie des Versprechens bei Thomas Hobbes
Martin Annen:
Die Idee des „stillschweigenden Vertrages“ und die Wahrhaftigkeitsfrage
Friedrich Vollhardt:
Von Thomasius bis Höpfner. Aspekte der naturrechtlichen Vertragslehre
im 18. Jahrhundert
Werner Hamacher:
Wilde Versprechen
III. Abgrenzungen vom Naturrecht
Bernd Lahno:
Treue als künstliche Tugend: Humes Theorie der Institution
des Versprechens
Michael Niehaus:
Recht der Sprache. Über die Stellung des Versprechens bei Jakob
Friedrich Fries und Leonard Nelson mit Rückgriff auf Kant
Armin Burkhardt:
Ein Vergleich zwischen der Versprechensanalyse Austin / Searles
und derjenigen Adolf Reinachs
IV. Genealogien des Versprechens
Gerald Hartung:
Zur Genealogie des Versprechens. Ein Versuch über die begriffsgeschichtlichen
und anthropologischen Voraussetzungen der modernen Vertragstheorie
Norbert Brieskorn:
Das Versprechen in „De legibus“ des Francisco Suárez
(1613)
Joseph Vogl:
1797. Geld als Versprechen
V. Fälle und Ausfälle
Wim Peeters:
Wie die Ordnungsworte vergessen. Ein Angebot
Peter Risthaus:
Wotans Fall - oder der traurige Gott als Rechtssubjekt
Clemens Pornschlegel:
Prinzipiell unverbindlich. Zu Robert Walsers Don-Juan-Glossen
Manfred Schneider:
Dem Versprechen entsprechen. Kontraktuelle Sprachmanöver
|